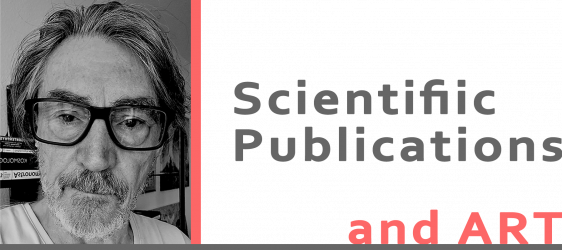Der griechische Philosoph Platon (Antike: 428/27 – 348/47 v. Chr.), postulierte: Die Wahrheit ist zweigeteilt.
Einleitung:
- Für ein grundlegendes Verständnis in diesem Abriss und aufgrund der breit gefächerten Ausprägungen des konstruktivistischen Gedankengutes, beschränkt sich der Beitrag auf den Radikalen Konstruktivismus und eine kurze Zusammenfassung der hieraus ableitbaren sozialkonstruktivistischen Sichtweisen.
Weitere konstruktivistische Denkmodelle: - Relationaler Konstruktivismus.
- Erlanger Konstruktivismus.
- Interaktionistischer Konstruktivismus.
- Kognitiver Konstruktivismus.
Fundament des konstruktivistischen Denken:
- Der Konstruktivismus ist keine in sich geschlossene, einheitliche Denkrichtung, sondern vielmehr ein Diskurs oder Diskussionszusammenhang.
- Grundsätzlich gilt, dass die Wahrnehmung keine Gegebenheiten einer von uns unabhängigen Realität abbildet, wie diese Gegebenheiten an sich sind. Wir entwerfen lediglich Modelle, deren Objektivität oder Wahrheit nicht prüfbar ist.
- Das einzelne Subjekt konstruiert aufgrund interner Kriterien sein gesamtes Erleben.
- Der zentrale Ausgangspunkt des Konstruktivismus ist demzufolge die Erkenntnistheorie, die schlicht danach fragt, wie Menschen Erkenntnisse und Wissen erlangen.
- Es gibt eine Art Gründungsdokument (Manifest) des kostruktivistischen Denkens, mit dem Titel Biology of Cognition (Humberto R. Maturana, 1970).
In diesem Dokument wird eine biologische Betrachtungsweise im Hinblick auf die Erkenntnistheorie vorgeschlagen. Das Dokument setzt somit den Prozess des Erkennens von der philosophischen Ebene in die Gebiete der Neurowissenschaft und Neurobiologie. Aus dieser Sichtweise folgt, dass das Subjekt ein Objekt studiert, dass es selber sein könnte, ein Gehirn erklärt quasi ein Gehirn – das Subjekt ist sich sein eigenes Objekt.
Die Konsequenzen aus der Mehrdeutigkeit von Wahrnehmung:
- Um die Übereinstimmung mit einer Handlung oder Theorie zu erhalten, müsste ein Subjekt seine Wahrnehmung mit der Realität vergleichen können. Die Wahrnehmung ist hierzu nicht in der Lage, denn sie kann nicht direkt auf die Realität zugreifen, sondern nur über die Wahrnehmung.
Oder anders formuliert: - Wahrheit im Sinne einer Eins zu Eins – Projektion mit der Realität ist ausgeschlossen, denn Wahrheit definiert man als objektiv, die die Welt zeigen soll, wie sie vor der Verarbeitung des Erkenntnisapparates (Hirn, Tastsinn, Geruchsinn u.s.w.) wahrgenommen wurde.
Trotz unvollständiger Methodologie, können für den Radikalen Konstruktivismus folgende Grundannahmen erstellt werden:
- Außerhalb eines Subjekts existiert keine Wirklichkeit.
- Wirklichkeit ist relativ und mit dem Subjekt verknüpft.
- Es gibt vielfältige Perspektiven.
- Intersubjektive Verständigung ist zwingend erforderlich, um Begründungszusammenhänge, Viabilität und Erfahrungen über Erfolg oder Misserfolg zu ermitteln.
- Viabilität entspricht einer rationalen Akzeptiertheit auf Zeit.
- Das Subjekt ist Beobachter erster und zweiter Ordnung und teilnehmender als auch mitgestaltender Akteur.
- Objektivität ist an Viabilität gebunden.
Maßgebliche Grundlagenforscher zum Radikalen Konstruktivismus:
Ernst von Glasersfeld (1917 – 2010) und Heinz von Foerster (1911 – 2002) gelten als Begründer des Radikalen Konstruktivismus im Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie.
Sie prägten maßgeblich den Viabilitätsbegriff im Hinblick auf den Konstruktivismus.
Eine Ergänzung aus sozialkonstruktivistischer Sicht kann man in den folgenden Punkten benennen:
- Wissenschaft muss Perspektivenvielfalt berücksichtigen und disziplinäre Grenzen überwinden.
- Methodisch gut geeignet sind narrative Interviews.
- Mit Diskursanalysen lassen sich soziale- steuerungs- und disziplinierende Regeln herausfinden. Die Offenlegung kann der Befreiung aus kulturellen Zwängen dienen.
- Perpektiven über Gruppen, Milieus und Subkulturen können Forschende am besten vor Ort mittels ethnographischer Methoden erfahren.
- Das Aufspüren von Veränderungspotenzial geht vorzugsweise mit Aktionsforschung. Die Betroffenen werden aktiv in den Forschungsprozess eingebunden.
Literaturverzeichnis:
- Bernhard Pörksen (2015). Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Springer VS.
- Holger Lindemann (2019). Konstruktivismus, Systemtheorie und praktisches Handeln. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Tilly Miller (2021). Konstruktivismus und Systemtheorie. Beltz Juventa.
- Fritz B. Simon (2023). Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus. Carl-Auer Verlag.